Deutschlands erster Quantencomputer läuft. Selbst die Bundeskanzlerin schwärmt vom Potential der Technologie. Doch bisher übertreffen Quantenrechner nur in Experimenten klassische Computer. Es könnte Jahrzehnte dauern, bis sie praktischen Mehrwert liefern, fürchten Kritiker. Europäische Start-ups wie Qu & Co oder IQM wollen dagegen beweisen, dass es viel schneller gehen könnte.
Von Wolfgang Kerler
Dramatische Musik. Die Erde schwebt in der Dunkelheit des Weltraums. Dann zoomt die Kamera immer weiter herein, nimmt uns mit in ein unscheinbares Gebäude irgendwo in Europa. Das rhythmische Schlagen eines Herzens ist zu hören. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins.
Der Vorhang fällt und eröffnet den Blick auf den mysteriös beleuchteten, raumhohen Glaskasten, um den sich an diesem 15. Juni 2021 alles dreht. IBM Quantum System One steht links unten auf der Ecke der Konstruktion. In ihrem Inneren hängt ein schimmernder Metallzylinder von der leuchtenden Decke. Applaus. Ein bisschen Jubel. Dann steht Martin Jetter von IBM Europe auf der Bühne. „Ganz herzlichen Dank. Und ein herzliches ,Grüß Gott‘ hier aus dem Schwabenland“, sagt er.
Unübersehbar und unüberhörbar ist der Quantencomputer in Deutschland angekommen. Ein Modell mit 27 Quantenbits, hergestellt vom US-Konzern IBM, betrieben gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft. Die aufwendige Show kann dabei durchaus übertrieben erscheinen. Denn keiner der derzeit auf der Welt verfügbaren Quantencomputer eignet sich für den kommerziellen Einsatz in der Industrie, auch nicht der in Ehningen bei Stuttgart. Dafür produzieren sie viel zu viele Fehler.
Und doch ist die Inbetriebnahme des IBM-Systems in Baden-Württemberg aus Sicht von Stefan Filipp ein Meilenstein. „Einerseits, weil wir beim Thema Quantencomputer jetzt eine richtige Aufbruchsstimmung in Deutschland spüren“, sagt er im Gespräch mit 1E9. „Andererseits, weil es entscheidend ist, jetzt die Möglichkeit zu haben, mit Quantencomputern zu experimentieren und mit ihnen zu erproben, welche Algorithmen wie gut funktionieren, damit wir möglichst schnell erste Anwendungen entwickeln können, die handfesten Mehrwert liefern.“
Stefan Filipp erforscht als Professor an der Technischen Universität München und als Direktor des Walther-Meißner-Instituts Quantencomputer, auch für IBM arbeitete er schon – und er beriet das Bundeskanzleramt, um eine politische Strategie zur Förderung der Zukunftstechnologie zu formulieren. Auch ihm ist es zu verdanken, dass die Bundesregierung das entstehende Quantenökosystem mit zwei Milliarden Euro zusätzlich unterstützt.
Das ist viel Geld. Aber es winkt auch ein Milliardenmarkt, sollten Quantencomputer den enormen Erwartungen gerecht werden. Lange klangen sie nach Science-Fiction. Doch in den USA bewies Google schon 2019, dass sie klassische Supercomputer hinter sich lassen können. Zumindest in einem Experiment. Auch aus China kommen laufend neue Erfolgsmeldungen. Deutschland und Europa müssen also aufholen – und dennoch genau wie alle anderen auf weitere Durchbrüche hoffen. Denn die größte offene Frage ist, wann Quantencomputer wirklich nützlich werden. In ein paar Jahren? Oder erst in Jahrzehnten?
Neue Materialien und viel Optimierung
Wie genau Quantencomputer funktionieren, ist schwer zu erklären. Worin ihr Vorteil gegenüber klassischen Computern liegt, lässt sich aber – stark vereinfacht – so sagen: Weil sie mit Qubits und nicht mit Bits arbeiten, können sie riesige Datenmengen in kürzester Zeit verarbeiten. Manche Berechnungen, die auf klassischen Computern Jahre dauern würden, schaffen sie – in der Theorie zumindest – in Sekunden.
Das könnte – theoretisch zumindest – die Simulation ganzer Moleküle möglich machen, was mit klassischen Computern undenkbar ist. Die Pharmaindustrie könnte damit viel schneller neue Wirkstoffe entwickeln. Die Erforschung neuer Materialien, zum Beispiel für bessere E-Auto-Batterien, könnte durch Quantencomputer ebenfalls einen Schub kriegen. Selbst die Abläufe der Kernfusion könnten sich simulieren lassen. Und auch komplexe Optimierungsprobleme könnten diese viel schneller lösen – vom Verkehrsmanagement in Großstädten über das Management von Fabriken und Lieferketten bis zur Vermögensverwaltung. Durch Quantum-Machine-Learning könnte auch Künstliche Intelligenz weiter verbessert werden.
Praktisch allerdings lässt sich mit den bisherigen Quantencomputern deutlich weniger anfangen. Denn die Qubits sind, vereinfacht gesagt, ziemlich scheu, was äußere Einflüsse angeht. Obwohl die Prozessoren im luftleeren Raum und bis fast auf den absoluten Nullpunkt gekühlt betrieben werden, lassen sie sich nur für den Bruchteil von Sekunden stabil für Berechnungen nutzen.
Die Folge: Heutige Geräte produzieren Fehler, auch Lärm oder „Noise“ genannt. Eine hohe Anzahl von Qubits, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen, könnte daran etwas ändern, weil mit ihnen die Fehler korrigiert werden könnten. Ein universeller Quantencomputer wäre damit möglich. Doch solche Maschinen dürfte es, etwa aus Sicht der amerikanischen National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, in den nächsten Jahren nicht geben.
Die derzeitigen, fehleranfälligen Top-Quantencomputer verfügen schließlich über weniger als hundert Qubits. Sie heißen deshalb auch Noisy Intermediate-Scale Quantum Computers, also Quantencomputer mittlerer Qubit-Anzahl, die viel Rauschen verursachen. Doch wenn es nach einigen Start-ups und großen Industriekonzernen geht, könnten auch die NISQs schon handfeste Quantenvorteile liefern – also Ergebnisse, die mit klassischen Rechnern schlicht nicht möglich wären.
Quantenalgorithmen für die Industrie
Zu denen, die keinen Zweifel daran haben, dass mit den Quantencomputern, die in den nächsten Jahren verfügbar sein werden, ein „industrierelevanter Quantenvorteil“ möglich ist, gehört Benno Broer. Er ist Gründer und Chef des niederländischen Start-ups Qu & Co, das Quantenalgorithmen entwickelt.
„Würde ich zu denen gehören, die glauben, dass das noch zehn Jahre oder mehr dauert, wäre ich doch nicht in dieses Business eingestiegen“, sagt er im Gespräch mit 1E9. Seine Schätzung: In drei bis fünf Jahren werde es erste kommerzielle Anwendungen geben. Die Voraussetzung dafür: Jetzt mit Prototypen und Experimenten starten – und das zusammen mit potenziellen Nutzern aus der Industrie. „Sonst kommen dabei vielleicht interessante akademische Forschungsergebnisse heraus, aber kein Produkt.“
Noch programmiert Qu & Co Algorithmen und Software im Prototypen-Zustand, zum Beispiel eine Plattform zur Simulation von chemischen Prozessen und neuen Materialien. Doch auch diese frühen Produkte ermöglichen es Partnern, erste Erfahrungen mit Quantencomputern zu sammeln und praktischen Anwendungen Schritt für Schritt näher zu kommen. Mit Airbus kooperiert das Start-up, um bessere Simulationen der Flugphysik zu ermöglichen. Mit einer Tochter des US-Konzern Johnson & Johnson will Qu & Co Methoden finden, die Forschung und Entwicklung in der Pharmabranche voranbringen können. Auch mit BMW, LG oder Covestro laufen Projekte.
Benno Broer ist überzeugt, dass man Wege finden wird, mit den NISQs, also den „lauten“ Quantencomputern, zu arbeiten – durch verbesserte Algorithmen, durch ganz neue Algorithmen und durch Hardware, die auf Anwendungen zugeschnitten wird. „Sicherlich wird es Enttäuschungen geben“, sagt er. „Aber wenn wir alle zusammenarbeiten – Software-Entwickler, Hardware-Anbieter und User – werden wir in drei bis fünf Jahren handfeste Ergebnisse erzielen.“
Um Software für Quantencomputer und den Umgang mit den Schwächen heutiger Systeme geht es auch in der aktuellen Ausgabe des Podcasts „SUHDO by 1E9“ von @tagphil. Er hat dafür mit Michael Marthaler, dem Chef des Quantencomputing-Start-ups HQS gesprochen. Hier findet ihr alle Folgen und könnt den Podcast abonnieren.
Chips, die auf bestimmte Anwendungen spezialisiert sind
Auch IQM Quantum Computing arbeitet daran, den Quantenvorteil schon in den kommenden drei bis fünf Jahren zu erzielen und kooperiert ebenfalls mit großen Konzernen, etwa mit Atos oder Infineon. IQM nähert sich allerdings von der Hardware-Seite an. Denn das finnische Start-up mit einer Tochtergesellschaft in München baut Quantencomputer. Vier davon stehen schon im eigenen Labor, einer bei einem Kunden in Finnland – und vom deutschen Forschungsministerium bekam ein IQM-geführtes Konsortium 12,4 Millionen Euro zugesichert, um einen 54-Qubit-Prozessor zu entwickeln.
Verstehe, was die Zukunft bringt!
Als Mitglied von 1E9 bekommst Du unabhängigen, zukunftsgerichteten Tech-Journalismus, der für und mit einer Community aus Idealisten, Gründerinnen, Nerds, Wissenschaftlerinnen und Kreativen entsteht. Außerdem erhältst Du vollen Zugang zur 1E9-Community, exklusive Newsletter und kannst bei 1E9-Events dabei sein. Schon ab 2,50 Euro im Monat!
Jetzt Mitglied werden!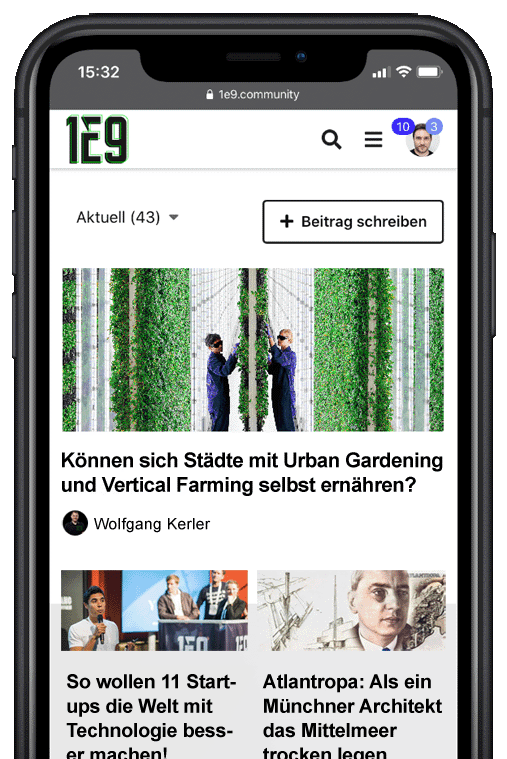
Bei IQM sollen für einen echten Vorteil gegenüber klassischen Rechnern keine Millionen von Qubits gebraucht werden, die in diesem Jahrzehnt wohl unerreichbar sein dürften. Schon ein paar Hundert sollen ausreichen. Denn IQM arbeitet nicht nur auf einen universellen Quantencomputer hin, sondern konzentriert sich zunächst darauf, Quantencomputer zu entwickeln, deren Hardware auf ganz spezifische Anwendungen zugeschnitten ist.
„Wir passen die Topologie unserer Chips an die Probleme an, die wir lösen wollen“, erklärt die Quantenphysikerin Inés de Vega im Gespräch mit 1E9. In ihrer Karriere als Wissenschaftlerin erforschte sie aus einer theoretischen Perspektive den „Lärm“, der die vielen Fehler verursacht, die heutige Quantencomputer noch plagen. Bei IQM fungiert sie nun als Head of Quantum Innovation – und hilft dabei, Quantenrechner trotz ihrer Fehleranfälligkeit nutzbar zu machen.
„Viele Quantenalgorithmen würden theoretisch nur ein paar Hundert Qubits brauchen, um zu funktionieren“, sagt sie. „Doch in der Praxis verursachen die Quantencomputer eben diese vielen Fehler und es braucht eine große Anzahl an Qubits, um diese zu korrigieren.“ Grundsätzlich gelte dabei: Je komplexer ein Algorithmus, desto länger dauere die Berechnung, desto mehr Fehler entstünden, etwa aufgrund der äußeren Störfaktoren.
Genau hier setzt IQM mit seinem Hardware-Software-Co-Design an. „Wenn der Chip des Computers bereits auf das Problem, das wir lösen wollen, abgestimmt ist, können wir effizientere, schlanke Algorithmen einsetzen, was zu weniger Fehlern führt.“ Vereinfacht gesagt: Die Hardware soll der Software einen Teil der Arbeit abnehmen. Die Software kann deshalb weniger komplex sein. Daher brauche man je nach Anwendung auch nicht so viele Qubits oder Operationen, um schneller eine Lösung zu finden, die zum Quantenvorteil führt, erklärt sie.
Möchte man etwa das Verhalten von physikalischen Systemen simulieren, zum Beispiel von komplexen Molekülen oder Materialien, biete es sich an, in das Chipdesign bestimmte Merkmale dieses Systems zu implementieren, nicht mit Qubits, sondern mit Resonatoren. „Wenn wir die Eigenschaften des Quantensystems simulieren, das wir untersuchen wollen“, sagt Inés de Vega. „dann ist es viel effizienter, eine Quantencomputer-Hardware zu entwerfen, die das System selbst so gut wie möglich abbildet oder repräsentiert.“ Die Erforschung neuer Materialien oder medizinischer Wirkstoffe könnte daher als erstes vom Quantenvorteil profitieren. Doch auch an Lösungen für Optimierungsprobleme etwa in der Finanzindustrie oder beim Quantum-Machine-Learning arbeitet IQM.
Die Abnehmer in der deutschen Industrie stehen bereit
Um als erste von Quantensoftware profitieren zu können – etwa durch bessere Batterien, optimierte Finanzportfolios, perfektionierte Produktionsabläufe oder neue Medikamente, die einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz bringen –, schlossen sich deutsche Konzerne aus mehreren Branchen zum Quantum Technology and Application Consortium, kurz: QUTAC, zusammen. Dazu gehören etwa Volkswagen, BMW, Siemens, Infineon, die Munich Re, Airbus, Merck oder BASF.
Sie alle wollen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups zusammenarbeiten und auch eigene Projekte starten, um ein deutsches und europäisches Ökosystem zu erschaffen. Denn wenn der große Festakt mit IBM zur Einweihung des ersten Quantencomputers in Deutschland eines gezeigt hat, dann die Abhängigkeit von amerikanischen Lieferanten.
„Unser Ziel muss also sein, dass wir in Deutschland eigene Quantencomputer bauen können“, sagt deshalb Stefan Filipp von der TU München. „Nur dann wissen wir ganz genau, wie die Hardware funktioniert – und was wir damit tun können.“ Doch auch ein Quantencomputer made in Germany – oder made in Europe – dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Ob in München oder Jülich, Freiburg oder Niedersachsen, vielerorts formieren sich gerade lokale Verbünde, um die Quantenzukunft mitzugestalten.
Live-Diskussion über Quantencomputer!
Ihr wollt noch tiefer ins Thema einsteigen? Dann schaltet am Donnerstag, dem 15. Juli 2021, um 17:00 Uhr zum nächsten digitalen Reclaim the Future! Event von 1E9 und dem FUTURE FORUM by BMW Welt ein. Das Thema: „Getting the Quantum Advantage on the Road“ Alle Infos zu den Speakern, zu denen neben Prof. Stefan Filipp, Benno Broer und Inés de Vega auch Andre Luckow von BMW gehört, und zum Stream findet ihr hier .
Titelbild: IBM
Hat dir der Artikel gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung! Werde Mitglied bei 1E9 oder folge uns bei Twitter, Facebook oder LinkedIn und verbreite unsere Inhalte weiter. Danke!






