Sie sind in Seen, Flüssen und im Meer. Selbst in Mineralwasser und Bier wurden sie nachgewiesen: winzige Kunststoffpartikel, bekannt als Nano- oder Mikroplastik. Wie lässt sich Wasser wieder davon befreien? Und wie können wir sicherstellen, dass gar kein Plastik mehr hineingelangt? Das gemeinnützige Start-up Wasser 3.0 hat eine Technologie entwickelt, mit der das gelingen könnte.
Von Wolfgang Kerler
Etwas unförmige, weiße Klumpen könnten die Lösung für ein weltweites Problem sein: Mikroplastik in nahezu allen Gewässern. In der Donau fanden österreichische Wissenschaftler schon Anfang des vergangenen Jahrzehnts mehr Plastikpartikel als Fischlarven. Das deutsche Alfred-Wegener-Institut entdeckte auch im Schnee Plastik – sei es in besiedelten Gebieten, den bayerischen Alpen oder der Arktis. Über amerikanischen Nationalparks scheint sich Plastik-Regen zu ergießen. Und im Meer – selbst in der Tiefsee – finden sich die winzigen Kunststoffteilchen ohnehin.
Sie lösen sich beim Waschen aus Kleidung, entstehen durch den Abrieb von Reifen, fallen in vielen Industrie an, kommen in Kosmetik zum Einsatz oder bleiben übrig, wenn größerer Plastikmüll im Wasser langsam zerfällt. Kläranlagen können das Mikroplastik nicht restlos beseitigen – und über das dann ausgeleitete Abwasser oder den Klärschlamm findet es seinen Weg auf Felder. Es wird damit ein Teil der Nahrungskette.
Auch in uns Menschen landet daher das Mikroplastik, über bestimmte Lebensmittel, die Luft, Staub, Getränke oder auch Kosmetik. Wie gefährlich das ist, darüber diskutiert die Wissenschaft noch. Während das Bundesinstitut für Risikobewertung derzeit laut seiner Homepage noch nicht annimmt, „dass von Mikroplastik in Lebensmitteln gesundheitliche Risiken für den Menschen ausgehen“, und auch eine Gefährdung durch Kosmetik mit Plastikpartikeln für unwahrscheinlich hält, warnen Organisationen wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Einig sind sich aber alle darin, dass die möglichen Auswirkungen auf Menschen noch besser untersucht werden müssen, um ein abschließendes Urteil zu fällen. Zumal Tests mit Tieren negative Auswirkungen zeigten. So wuchsen Lachslarven schlechter, wenn sie in stark mit Plastik belastetem Wasser schlüpften. Außerdem bewegten sie sich weniger – und bemerkten Fressfeinde zu spät. Eine tödliche Beeinträchtigung.
Mit Low-Tech gegen Mikroplastik – überall
Die promovierte Chemikerin Katrin Schuhen, die schon für die Kunststoffindustrie und als Juniorprofessorin an der Universität Koblenz-Landau arbeitete, ist sich sicher, dass Mikroplastik einen Effekt auf das Ökosystem hat. „Der Kunststoff ist nicht abbaubar und verweilt sehr lange in der Umwelt“, sagt sie im Gespräch mit 1E9. „Außerdem sprechen wir nicht von einzelnen Polymerpartikeln, sondern von vielen unterschiedlichen Typen und Verarbeitungsprodukten und außerdem stetig wachsenden Mengen. Mikroplastik ist nicht nur per se ein menschengemachtes Umweltproblem, es ist auch ein global vorhandenes. Außerdem können sich aus Mikroplastik auch andere kritische Substanzen lösen und damit in die Umwelt gelangen. Dadurch könnte ein unkontrollierbarer Mechanismus in Gang kommen – und alles, was man nicht kontrollieren kann, birgt Gefahren.“ Zumal mit dem Plastik andere Stoffe, die eine nachweisbare Gesundheitsgefahr darstellen, ins Wasser gelangten. Weichmacher zum Beispiel.
Werde Mitglied von 1E9 – schon ab 3 Euro im Monat!
Als Mitglied unterstützt Du unabhängigen, zukunftsgerichteten Tech-Journalismus, der für und mit einer Community aus Idealisten, Gründerinnen, Nerds, Wissenschaftlerinnen und Kreativen entsteht. Außerdem erhältst Du vollen Zugang zur 1E9-Community, exklusive Newsletter und kannst bei 1E9-Events dabei sein.
Jetzt Mitglied werden!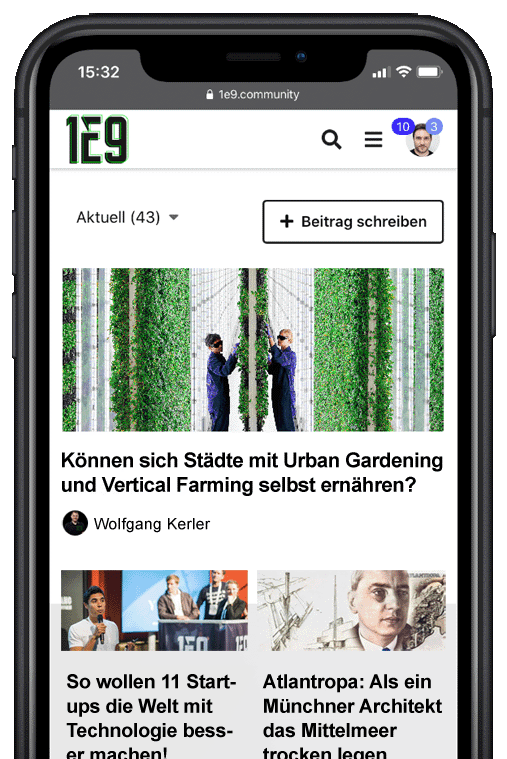
Deshalb plädiert Katrin Schuhen dafür, das Wasser vom Mikroplastik zu reinigen – und in Zukunft gar kein Mikroplastik mehr hineinkommen zu lassen. Und damit wären wir wieder bei den weißen, unförmigen Klumpen. Denn zu denen lässt sich das Mikroplastik durch ein Verfahren bündeln, das Katrin Schuhen und ihr Team von Wasser 3.0 entwickelt haben. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des nicht-kommerziellen Start-ups mit Sitz in Karlsruhe.
„Unser Ziel ist sauberes Wasser – und das weltweit“, sagt sie. „Deswegen setzen wir bei unseren Lösungen auf einen Low-Tech-Ansatz , der nicht nur nachhaltig, sondern auch kosten- und ressourceneffizient ist. Unsere Technologie ist weltweit einsetzbar, nicht nur in Industrieländern, die sich teures Equipment leisten können und über viele Fachkräfte verfügen.“
Die mobilen Container, in denen Wasser 3.0 die eigene Technologie verbaut, lassen sich überall aufstellen, wo Wasser gereinigt werden muss: in Kläranlagen, Fabriken oder dort, wo Meerwasser genutzt wird. Was in den Containern passiert, ist die Agglomerationsfixierung des Mikroplastiks. „Für uns als Chemiker hört sich das ziemlich gut an“, sagt Katrin Schuhen. Für Nicht-Chemiker lässt sich das Verfahren mit der englischen Formulierung clump and skim noch etwas simpler auf den Punkt bringen, auf Deutsch: verklumpen und abschöpfen.
Recycling in der Bau- oder Glasindustrie
In einem ersten Schritt wird das Wasser gerührt, damit sich das Plastik in einer Wasserschicht sammelt. Dann wird die „magische Zutat“ dazugeben, wie Katrin Schuhen sie nennt. Ein spezielles Hybridkieselgel, das aus verschiedenen Substanzen so zusammengemischt wurde, dass alle Kunststoffpartikel damit reagieren – und Klumpen bilden, die sich leicht abschöpfen lassen. „Im Prinzip funktioniert es wie bei einem Zwei-Komponenten-Kleber.“
Das Gel ist ungiftig. Aus seinem Hauptbestandteil Siliciumdioxid, bekannt als Kieselsäure, besteht auch Quarzsand. „Und wenn der giftig wäre, könnten wir uns im Sommer nicht an den Strand legen“, erklärt die Chemikerin.
Die Agglomerate – oder: Klumpen – könnten verbrannt werden und so als Energiequelle genutzt werden. „Das ist aber nicht unsere Lösung“, sagt Katrin Schuhen. „Wir wollen, dass sie wiederverwertet werden.“ Möglich wäre das etwa als Füllstoff in der Bau- oder Glasindustrie. Forschungsprojekte mit Partnern laufen bereits. Doch damit diese Form von Recycling Sinn ergibt, braucht es größere Mengen des Materials. Dafür wiederum müsste die Technologie von Wasser 3.0 noch häufiger zum Einsatz kommen. Dass sie in Kläranlagen, mit Süß- und Salzwasser oder auch mit industriellen Abwässern funktioniert, hat sie in Tests bereits bewiesen.
Kläranlagen sind nicht so gut wie ihr Ruf
Sorgen bereiten Katrin Schuhen allerdings die Nachwirkungen einer Schweizer Studie. Diese kam im vergangenen Jahr zum Ergebnis, dass 98 Prozent der winzigen Plastikpartikeln bereits jetzt von modernen Kläranlagen aus dem Abwasser herausgefiltert werden. Ist die Lösung von Wasser 3.0 also überflüssig? „Nein“, sagt die Firmenchefin. „die Kommunikation rund um die Studie war leider etwas einseitig.“ Denn anders als das Verfahren von Wasser 3.0, das das Mikroplastik in Klumpen bündele und damit tatsächlich beseitige, könnten Kläranlagen die Teilchen eben nicht eliminieren . „Sie landen im Klärschlamm“, sagt Katrin Schuhen. „Und wird der zum Beispiel in der Landwirtschaft verwendet, gelangt das Plastik wieder ins Ökosystem. Wird der Schlamm verbrannt, gehen Ressourcen verloren, nachhaltige Kreislaufwirtschaft sieht anders aus.“
Außerdem will Wasser 3.0 nicht erst in den Kläranlagen ansetzen, sondern schon viel früher. „Wir wollen dazu beitragen, dass sich Mikroplastik gar nicht erst verbreiten kann.“ Deshalb hofft Katrin Schuhen auf den Einsatz ihrer Technologie in einer ganzen Reihe von Industrien, die Kunststoffe verarbeiten – und Mikroplastik verursachen.
Plastik abschaffen will sie übrigens nicht – mit Ausnahme von Einwegprodukten, die einmal kurz genutzt werden und dann im Müll oder schlimmstenfalls in der Natur landen. „Wir werden auch weiterhin Kunststoffe brauchen“, sagt sie. „Aber dort, wo wir sie vermeiden können, sollten wir das auch machen. Und vor allem sollten wir Plastik recyceln und dafür sorgen, dass es nicht in die Umwelt gelangt.“ Damit nicht nur in der Donau irgendwann wieder mehr Fischlarven als Plastikpartikel herumschwimmen.
Titelbild: Getty Images




