Ist es ein Ansatz, eine Methode oder ein Prozess? Egal. Klar ist, dass Design Thinking hinter vielen neuen Produkten und Dienstleistungen der letzten Jahre steckt. Aber werden wir durch immer neue Design-Thinking-Workshops auch Lösungen für globale und gesellschaftliche Probleme finden? Eher nicht, meint Simon Höher vom Hybrid City Lab. Aus seiner Sicht muss es jetzt viel stärker auch um „verantwortungsvolles Design“ gehen.
Ein Interview von Wolfgang Kerler
Ausgehend vom Silicon Valley eroberte das Design Thinking in den vergangenen zwei Jahrzehnten Start-ups und Konzerne, Behörden und Nichtregierungsorganisationen. Es scheint also was dran zu sein an der ursprünglich von David Kelley, dem Gründer der Designagentur IDEO, sowie den Stanford-Professoren Terry Winograd und Larry Leifer entwickelten Idee. Der Grundgedanke dabei: Die Bedürfnisse und Wünsche von Nutzern sollen im Zentrum des Designprozesses stehen. Multidisziplinäre Entwicklungsteams sollen im stetigen Austausch mit der Zielgruppe arbeiten – und Produkte Schritt für Schritt verbessern. Außerdem spielen viele bunte Zettel, Stuhlkreise und immer neue Prototypen eine zentrale Rolle.
Auch Simon Höher setzt in seiner Arbeit auf Design Thinking, wünscht sich im Interview mit 1E9 aber weitere Fortschritte. Nutzerzentrierung allein reicht aus seiner Sicht nicht. Was ist mit anderen Menschen, die von Designentscheidungen betroffen sind? Was ist mit der Natur? Welche Verantwortung müssen Designer übernehmen? Wie kann man sich Problemen wie der Klimakrise annähern, bei denen unklar ist, wer hier Nutzer ist oder nicht?
Simon leitet das Hybrid City Lab, das Public Design Studio der Berliner Strategieberatung zero360. In seiner Arbeit unterstützt er private, öffentliche und zivilgesellschaftliche Organisationen dabei, eine gemeinsame und wünschenswerte Zukunft mitzugestalten. Dazu entwickelt er Strategien, digitale Produkte und Services und teilt seine Ideen und Fragen als Redner und Mentor – zuletzt als Dozent und Artist in Residence an der Fakultät für Social Design der Universität für Angewandte Künste in Wien.
1E9: Simon, wir wollen über Design reden. Aber was ist Design überhaupt?
Simon Höher: Eine kurze Antwort wäre: Design ist Gestalten, das Gestalten unserer Umwelt, unserer physischen Umwelt, unserer sozialen Umwelt. Was ich außerdem immer mit dem Gestalten zusammen denken und umsetzen würde, ist das Entdecken der Welt. Man kann nur spannende, gute, innovative Dinge gestalten, wenn man sich immer wieder darauf gefasst macht, neue Sachen zu entdecken.
Das Wort „Design“ wurde in den vergangenen Jahren sehr, sehr oft in Verbindung mit dem Wort „Thinking“ verwendet. Kaum jemand dürfte Design-Thinking-Workshops entkommen sein. Und eigentlich ist das auch eine gute Sache, wenn plötzlich die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt stehen und nicht mehr die manchmal technokratischen Vorlieben des Managements eines Konzerns, oder?
Simon Höher: Ich find’s eine gute Sache, auf jeden Fall. Die Entwicklung ist super. Aber sie ist mit Design Thinking oder mit Human Centered Design, was damit zusammenhängt, nicht zu Ende. Es war aus meiner Sicht nur der erste Schritt, zu verstehen, dass große Organisation ihre eigenen Logiken, ihre eigene Dynamik haben, sei es eine Verwaltung, ein Management, eine Entwicklungsabteilung. Denn wenn immer nur Produkte gestaltet werden, die aus diesen Logiken entstehen, dann vergessen wir dabei schnell die Menschen, für die wir diese Produkte eigentlich bauen. Mit Design Thinking oder Human Centered Design stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt – ein echter Fortschritt.
Die Welt ist aber komplizierter. Immer nur den Menschen – eigentlich: immer nur den Nutzer unseres Produktes – in den Mittelpunkt zu stellen, reicht nicht. Wir sollten herauszoomen und stärker den Kontext berücksichtigen, in dem er sich bewegt. Neben der Kundin betrifft unser Produkt vielleicht die Nachbarin oder jemanden, der einfach nur über die Straße geht. Dazu kommt eine Reihe von nicht-menschlichen Akteuren: Tiere, Natur, Umwelt, aber auch Bots und Technologien. Unsere Produkte haben einen Einfluss auf diese Akteure und umgekehrt. Die Coronakrise und aktuelle Naturkatastrophen reiben uns unter die Nase, wie groß deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und unser Leben sind. Nachdem wir erkannt haben, dass wir einen blinden Fleck haben – den Menschen oder den Nutzer –, müssen wir jetzt einsehen, dass wir immer noch einen blinden Fleck haben. Und der besteht aus allem, was nicht Nutzer und nicht Mensch ist.
Hast du Beispiele für Produkte, von denen du sagen würdest, sie befriedigen die Bedürfnisse der unmittelbaren Nutzer, aber nicht die der anderen Akteure – und richten daher in Summe mehr Schaden als Nutzen an?
Simon Höher: Sorry, wenn ich mit der Keule komme, aber: Autos. Vielleicht nicht alle Autos, aber mit Sicherheit fast alle SUVs. Klar gibt es gute Argumente, die dafürsprechen, Autos zu nutzen. Aber wo ist die Grenze, die ich als Designerin oder Designer selbst ziehe? Man kann sich durchaus überlegen, ob man SUVs oder kleine Elektroautos gestalten will – anstatt zu sagen, diese Grenze soll die Gesellschaft für mich ziehen.
Oder nehmen wir Candy Crush. Oder TikTok. Oder Instagram. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Natürlich adressieren diese Apps und Plattformen ganz gezielt bestimmte Bedürfnisse, die Menschen haben. Sie sind bunt, aufreibend und dramatisch, es gibt viel zu klicken und sie machen lustige Geräusche. Ich will eigentlich immer dabeibleiben. Aber wer steht dabei im Mittelpunkt? Ich finde, wir sollten mehr über die Verantwortung von Designerinnen und Designern sprechen. Der Begriff von verantwortungsvollem Design ist doch auch viel leistungsfähiger als der von Human Centered Design.
Bei verantwortungsvollem Design muss ich mir allerdings schwierige Fragen stellen: Wofür übernehme ich die Verantwortung? Welche Auswirkung hat meine Entscheidung auf all die anderen Akteure in dem System, in dem wir uns bewegen? Das wird in den allerwenigsten Ausbildungsprogrammen für Design überhaupt erwähnt, geschweige denn umgesetzt. Dafür gibt es auch keine Methodologie, die mir sagt, wenn X dann Y. Oder: In fünf Schritten hast du eine Innovation, wie Design Thinking manchmal angepriesen wird. Man kommt nicht aus seiner Haut, zu sagen: Dafür stehe ich jetzt im Guten wie im Schlechten.
Aber wie macht man es dann, dass man ein Produkt oder ein System designt und dabei nicht nur die unmittelbaren Nutzer, sondern auch die anderen Betroffenen miteinbezieht?
Simon Höher: Es gibt eine ganze Reihe von vielversprechenden Ansätzen, sich dem zu nähern, die auch alle nicht ganz neu sind. Dazu gehört die Idee von Design for Conversation, die zum Beispiel Ranulph Glanville ins Spiel gebracht hat. Das heißt, ausgehend von seinen blinden Flicken und betriebsblinden Vermutungen sollte man sich von vornherein darauf einstellen, dass Designprozesse eigentlich Gespräche sind. Man gestaltet also vor allem den Gesprächsprozess zwischen allen betroffenen Akteuren.
Unsere Arbeitsergebnisse sind immer nur die Anfangsbedingungen unserer Nachfolger.
Eine zweite Sache ist, dass man sich bewusst machen sollte, dass man die Welt heute mit Sicherheit anders sieht als man sie vor fünf Jahren gesehen hat – und als man sie in fünf Jahren sehen wird. Unsere Arbeitsergebnisse sind immer nur die Anfangsbedingungen unserer Nachfolger. Und diese Vorstellung, die Herbert Simon aufgebracht hat, finde ich als Grundidee relevant, weil man dann bei einem Begriff landet, den der Stadtforscher und Planer Lucius Burckhardt ausgerufen hat: dem kleinstmöglichen Eingriff. Das bedeutet, wir sollten davon ausgehen, dass es eine ganze Reihe von Umständen gibt, die sich immer wieder ändern können, und uns deshalb mit unseren Annahmen nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Die Frage lautet dann: Wie können wir jetzt so handeln und gestalten, dass unsere Entscheidungen reversibel oder zumindest anpassbar und möglichst offen für alle weiteren Nachfolger sind, die damit weiterarbeiten müssen. Burckhardt hat sich viel mit Städten beschäftigt, in denen wir sehen, dass unsere Eingriffe eine Faktenlage für Jahrzehnte und mehrere Generationen schaffen. Heute finden alle die autofreie Stadt super, aber sie angesichts der Entscheidungen aus den 1950er Jahren umzusetzen, ist ein riesiger Aufwand.
Diese Grundeinstellung – also, was immer wir jetzt gestalten, muss anpassbar sein – verbunden mit der Vorstellung von Design als der Gestaltung eines Gesprächsprozesses, der möglichst viele Akteure mit einbezieht, könnte uns aus meiner Sicht weiterbringen – und ist jetzt nicht so verrückt umzusetzen.
Hast du Beispiele, wo sowas schon gelungen ist?
Simon Höher: Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit dem Prototype Fund. Das ist eine Public-Interest-Tech-Initiative der Open Knowledge Foundation zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Der Fund unterstützt Open-Source-Projekte, die irgendeine Art von öffentlichem Interesse verfolgen. Es geht also um super viele kleine Initiativen, nicht darum, die nächsten Facebooks zu bauen.
Wir coachen die Teams und ich bin immer wieder fasziniert. Es gibt unglaublich viele super relevante Ideen, die dort auftauchen – und die alle im öffentlichen Interesse sind, was die Erkenntnis voraussetzt, dass man Verantwortung übernehmen muss. Das heißt, man muss sich schon Gedanken gemacht haben, was überhaupt im öffentlichen Interesse ist und was nicht. Die Projekte adressieren spezifische Probleme von Menschen: vom Syrian Archive, das dabei hilft, Menschenrechtsverletzungen digital zu dokumentieren, bis zu Lösungen, die die Privatsphäre von Menschen im digitalen Raum schützen.
Beim Design Thinking, beim Human Centered Design und selbst beim gerade beschriebenen Vorgehen geht es im ersten Schritt oft vor allem darum, die Probleme von Menschen zu identifizieren – und dann Lösungen dafür zu entwickeln. Für eine Kaffeemaschine oder eine Shopping-App funktioniert das auch wunderbar, vielleicht auch noch für die Umgestaltung eines städtischen Parks. Aber stößt das Konzept bei Herausforderungen wie der Klimakrise oder der Polarisierung der Gesellschaft nicht trotzdem an seine Grenzen? Was ist da das konkrete Problem? Und wer sind die User?
Simon Höher: Systemische Probleme oder Wicked Problems haben eine ganze Reihe von merkwürdigen Charakteristika: Zum Beispiel weiß man erst, was genau das Problem war, wenn man die Lösung schon gefunden hat. Und es ist relativ willkürlich, zu sagen: Hier beginnt das Problem und hier hört es auf. Wer hat ein Problem wie die Klimakatastrophe? Alle und niemand. Diese systemischen Probleme sind auch deswegen so resistent, weil es unfassbar schwierig ist, zentrale Mandate und Stakeholder zu finden.
Der eine trennt Müll, der nächste fliegt weniger, der dritte holt CO2 aus dem Himmel.
Aber genau für solche Probleme finde ich den Ansatz Design for Conversations so spannend. Anstatt davon auszugehen, dass wir solche Probleme mit ein paar einfachen Schritten lösen können, sollten wir uns vielleicht eher vornehmen, zu gestalten, wie wir denn als Gesellschaft mit diesen Problemen umgehen, wie wir darüber reden und welche Entscheidungen wann wie von wem getroffen werden, um dann ganz viele kleine Entscheidungen hinzukriegen. Ich persönlich bin eher ein Fan von dezentralem koordiniertem Handeln in eine grundsätzliche Richtung, auf die wir uns als Gesellschaft verständigt haben, als von dem einen großen Anführer, der weiß, wo die Reise hingehen soll. Jeder leistet dabei so seinen kleinen Beitrag, zum Beispiel im Klimakontext: Der eine trennt Müll, der nächste fliegt weniger, der dritte holt CO2 aus dem Himmel.
Aber wie kommen wir zu dieser gemeinsamen Richtung?
Simon Höher: Dafür braucht es Geschichten, die alle nachvollziehen können. Man muss also versuchen, eine größere Geschichte zu erzählen, auf die sich alle einlassen können und wollen. Das kann man, glaube ich, auch hinkriegen, ohne ein Demagoge zu sein. Und das passiert auch schon in Form von Narrativen, die in unserer Gesellschaft herumschwirren.
Verstehe, was die Zukunft bringt!
Als Mitglied von 1E9 bekommst Du unabhängigen, zukunftsgerichteten Tech-Journalismus, der für und mit einer Community aus Idealisten, Gründerinnen, Nerds, Wissenschaftlerinnen und Kreativen entsteht. Außerdem erhältst Du vollen Zugang zur 1E9-Community, exklusive Newsletter und kannst bei 1E9-Events dabei sein. Schon ab 2,50 Euro im Monat!
Jetzt Mitglied werden!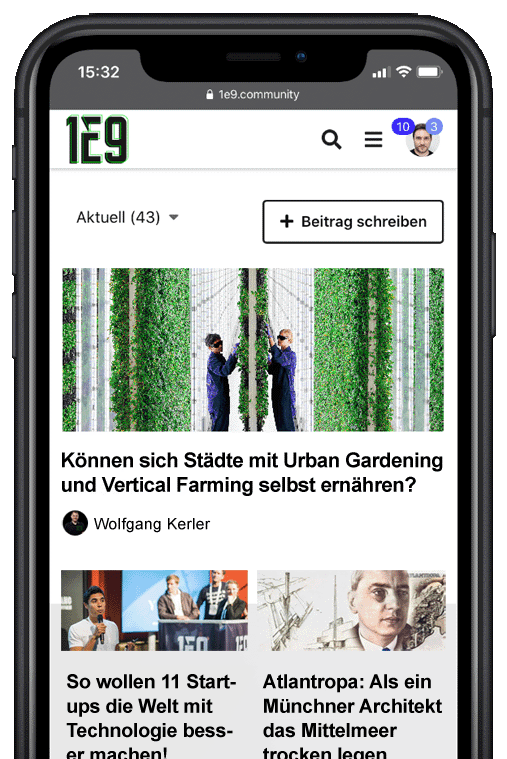
Nehmen wir an, eine Designerin liest jetzt dieses Interview und stellt sich jetzt die Frage, ob ihre Arbeit überflüssig ist, weil sie bisher „nur“ Kaffeetassen gestaltet. Was würdest du ihr raten?
Simon Höher: Erstmal: nichts gegen Kaffeetassen! Ich meine nicht, dass jetzt jeder alles stehen und liegen lassen muss, um an den Grundfesten unserer Welt zu schrauben, weil wir es nur so schaffen. Mir geht es eher um eine andere Haltung. Man kann auch Kaffeetassen gestalten und dabei eine Haltung einnehmen, zum Beispiel zum Kontext, in dem diese Kaffeetassen stehen: Wie werden sie produziert? Wer verdient daran Geld? Was mache ich eigentlich mit dem Geld, das ich daran verdiene? Wenn man die Perspektive hat „alles, was ich mache, sind Kaffeetassen, der Rest interessiert mich nicht“, dann wird man eine ganze Reihe von Gestaltungsentscheidungen gar nicht bewusst treffen können.
Man sollte sich also fragen: Was sind eigentlich die größeren und kleineren Spuren, die ich so hinterlasse. Vielleicht hat man über drei Ecken, auch wenn man „nur“ Kaffeetassen gestaltet, einen großen Einfluss auf die Welt? Bei dieser Spurensuche, diesem Fährtenlesen finde ich die Pilzmetapher schön. Eigentlich vernetzen Pilze unterirdisch den gesamten Wald, aber man sieht nur ab und zu mal einen Fruchtkörper.
Eine kurze Frage für den Schluss: Lässt sich die Welt mit Design Thinking retten?
Simon Höher: (Zögert.) Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe so lange überlegt, weil ich mich gefragt habe, was denn „Welt retten“ eigentlich heißt. Wo wollen wir eigentlich hin? Wenn wir das nicht wissen, können wir auch nicht genau sagen, ob Design Thinking dafür funktioniert oder nicht. Meine Vermutung wäre aber: Egal, welches Problem wir finden, Design Thinking allein ist nicht die Lösung.
Hat dir der Artikel gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung! Werde Mitglied bei 1E9 oder folge uns bei Twitter, Facebook oder LinkedIn und verbreite unsere Inhalte weiter. Danke!
Titelbild: Getty Images

