Die Menschheit hat seit Mitte des 20. Jahrhunderts riesige Mengen Plastik produziert. Ein Teil davon ist als Mikroplastik in unsere Böden gelangt und gefährdet möglicherweise nicht nur die dortigen Lebewesen, sondern auch die Bodenfruchtbarkeit. Was tun wir jetzt?
Von Fredi Büks
Als das 19. Jahrhundert sich seinem Ende zuneigte, war die Menschheit gerade dabei, Wissenschaft und Produktherstellung dauerhaft zu verbinden und entwickelte etwas epochal Neues. Es war ein Material, das in den folgenden Jahrzehnten wegen seiner außergewöhnlichen Eigenschaften zunächst als besonders edel gelten sollte, dann seit den 1970ern Schritt für Schritt zum billigen Trash wurde und unseren Alltag heute auf allen Wegen begleitet. Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung des letzten Jahrhunderts haben wir gelernt, so viel Kunststoff zu produzieren, dass ihn wegzuwerfen uns nicht mehr schwerfällt. Erst in der zukünftigen postfossilen Welt, so sagen uns manche Science-Fiction-Geschichten, wird es dann wieder posh sein, Plastikbesteck zu besitzen und mit alten Barbies in Glaskästen vor Gästen zu prahlen, weil Plastik wieder seltenes Luxusgut ist.
Doch auch wenn in dieser fiktionalen Nachplastikwelt Kunststoffe in Alltagsgegenständen und ihren Verpackungen selten geworden sein werden, so haben unsere Vorfahren und wir schon längst einen Plastikfußabdruck in den Ökosystemen der Erde hinterlassen. Jene hyperintelligenten Riesenkakerlaken, die dereinst nach den Zeiten des Homo sapiens kopfschüttelnd über der Geologie des Anthropozäns brüten werden, könnten ihn als Zeichen unseres schlechten Umgangs mit Ressourcen erkennen. Was würden wir ihnen sagen, wie es dazu kam, dass sie unzählige, winzige Plastikfragmente in ihren Proben von Sedimentgesteinen finden?
Vom Spezialmaterial zur Massenware
Alles Plastik, das die Menschheit bis heute produziert hat, entspricht einem Würfel von etwas über zwei Kilometer Kantenlänge. Das sind etwa 8.300.000.000 Tonnen, von denen 2.000.000.000 Tonnen noch im Gebrauch sind, während der Rest sich bereits in Abfall verwandelt hat. Weltweit wurden davon nur etwa 21 Prozent recycelt oder zur Energiegewinnung verbrannt. Der Rest wurde deponiert oder ist in der Umwelt gelandet, zwei Lebenswege, die man zum Beispiel aufgrund wilder Deponien oft nicht wirklich auseinanderhalten kann.
Doch bevor es zu so viel Müll kam, führten Kunststoffe im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunächst in geringer Produktionsmenge ein Nischendasein für Spezialanwendungen, etwa für die Gehäuse der noch seltenen Telefone, für Filme oder Kleider aus Synthetikfaser. Es war die Zeit, in der man die meisten der heute gebräuchlichen Plastiksorten entwickelte – PVC (1912), PS (1931), PE (1935), PU (1937), Teflon (1938), PET (1941) und dann PP (1954). Nach dem 2. Weltkrieg wurde ihre Produktion billiger, ihre Anwendung breiter, und die Produktionsmenge schoss exponentiell in die Höhe. Plötzlich waren Kunststoffe überall. In den Folgejahrzehnten blieb ihre marktbeherrschende Stellung erhalten, aber ihre Rezeptur veränderte sich peu à peu, indem sie durch immer neue Zusatzstoffe flexibler, stabiler oder unempfindlicher gegen den UV-Anteil des Sonnenscheins gemacht wurden. Durch diese Modifikationen erhielt das Plastik zugleich seine enorme Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, die verhindert, dass es in der Natur in überschaubarer Zeit von Bakterien und Pilzen abgebaut werden kann.
Für die Böden und ihre Bewohner wird es unangenehm
So war es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die Produkte unseres Alltags auch in der Natur wiederfanden. Das Thema Mikroplastik wurde erstmals öffentlich diskutiert, als Forscher:innen in den 1970ern an den Stränden Neuseelands neben angeschwemmtem Plastikmüll auch zahllose sandkorngroße Kunststoffpartikel fanden. Das Plastik musste dorthin gelangt sein, nachdem Kunststoffmüll in den Meeren versprödet und durch den Wellengang am Strand zerrieben worden war. Größeren Plastikabfall hatte man schon in den 1960ern in großen Mengen in den Mägen von verendeten Seevögeln gefunden, wie der britische Meeresbiologe Richard C. Thompson in seinem 2009 erschienenen Artikel Our plastic age beschreibt. Nun aber entstand auch Aufmerksamkeit für den unsichtbaren Müll.
Wegen dieser frühen Entdeckungen im marinen Bereich und weil Mikroplastik viel einfacher aus Wasserproben abzutrennen und zu analysieren ist als etwa aus Bodenproben, weitete sich die Forschung schnell auf Süßwasserökosysteme wie Flüsse und Seen aus, wo ebenfalls kleine Plastikfragmente gefunden wurden. Heute verfügen wir deshalb durch viele Gewässerstudien über ein umfangreiches Wissen und eine gute Datenlage zum Mikroplastik im Wasser. Böden wurden hingegen zunächst ignoriert und bekamen erst in den 2010ern Öffentlichkeit.
Als Problem für Böden wurde Mikroplastik erstmals 2012 wissenschaftlich diskutiert und vier Jahre später seine Menge in einem Industriegebiet bei Sydney bestimmt. Es folgten eine Reihe von Studien, durch die wir heute wissen, dass wir in Böden im Schnitt etwa ein Milligramm bzw. etwa 1000 Partikel pro Kilogramm Boden finden. Auf landwirtschaftlichen Flächen und in der Nähe von Städten sind diese Messwerte etwa viermal so hoch, während Werte aus Industriegebieten sie um das 100- bis 1000fache übertreffen können. Die eigentlichen Konzentrationen dürften dabei noch größer sein, da die zur Verfügung stehenden Messmethoden Mikroplastikpartikel mit einer Größe unter fünf Mikrometer nicht erfassen können.
Diese Zahlen sagen uns, dass sich die Mikroplastik-Konzentrationen in unseren Böden im Grenzbereich zu einer schädlichen Wirkung auf den Boden und sein Bodenleben befinden. In einer Begutachtung aller bis Januar 2020 erschienenen Studien zur Wirkung von Mikroplastik auf Bodenlebewesen wurden starke Hinweise gefunden, dass Mikroplastik von Bodenorganismen aufgenommen wird und ihre Gesundheit schädigen kann.
Zu den Krankheitssymptomen gehören ein reduziertes Körperwachstum, eine geringere Zahl von Nachkommen, eine verkürzte Lebensdauer oder auch entzündliche Erkrankungen des Verdauungstrakts. Im Zusammenhang mit großen Partikeln mit einem Durchmesser von mehr als 100 Mikrometern traten diese Effekte zwar erst bei Konzentrationen von 100 bis 1000 Milligramm pro Kilogramm Boden auf, also bei Werten, die weit über den Gehalten von normalen Ackerböden liegen. Leider scheint das aber nicht für die viel kleineren Partikel an der Grenze der Messbarkeit zu gelten. Denn Mikroplastik mit weniger als zehn Mikrometern Durchmesser bewirkt solche Erkrankungen schon bei Konzentrationen, wie wir sie im Feld finden. Da auch die großen Plastikstücken im Boden mit der Zeit immer kleiner werden, sollten wir ruhig jetzt schon besorgt sein, denn gerade die Fruchtbarkeit unserer Böden hängt von einem gesunden Bodenleben ab.
So reichert sich Mikroplastik im Boden an
Es wird auf absehbare Zeit keine Methode geben, Mikroplastik aus einem Boden zu entfernen, ohne ihn zu zerstören. Deshalb müssen wir uns Gedanken machen, wie wir vorsorgen und zumindest die weitere Kontamination vermeiden können. Daher macht es Sinn, einen kurzen Blick auf die wichtigsten Eintragspfade zu werfen. Landwirt:innen verwenden Klärschlämme, um Nährstoffe auf ihre Felder zurückzuführen. Dieses Verfahren macht Sinn, ist aber auch in Verruf, weil durch kontaminierte Klärschlämme und Abwässer zum Beispiel Schwermetalle, Antibiotikaresistenzen oder eben auch winzige Textilfasern aus Kunststoff aus der Wäsche von Millionen von Haushalten in den Boden gelangen. Geben wir also auf, die Nährstoffe aus den Städten in dieser einfachen Form wieder auf das Land zurückzuführen, oder schaffen wir es, unsere Klärschlämme sauber zu halten?
Komposte aus Bioabfällen wiederum werden ebenso als Bodenverbesserer eingesetzt, sind aber fast immer mit Mikroplastik, etwa von Plastikmülltüten, durchsetzt. Auch auf dem Acker selbst erzeugen Landwirt:innen ungewollt Mikroplastik, indem Mulchfolien eingesetzt werden, um den Boden vor Verdunstung zu schützen und den Aufwuchs von Beikräutern zu verhindern. Unter der harten Sonne verspröden und zerfallen sie auf dem Acker und lassen Plastikstücke zurück. Das Bewässern von Äckern und Gärten mit Abwasser oder kontaminiertem Flusswasser bringt ebenso Plastikpartikel in den Boden wie das Anwehen von Reifenabrieb und anderen feinen Partikeln oder das Vermüllen der Landschaft und die anschließende Verwitterung des Abfalls. Ein sehr bedeutender Eintragspfad in Ackerböden scheint außerdem der Einsatz von feinen Kunststoffhüllen zu sein, mit denen Mineraldüngerkörner überzogen werden (engl. coating ), damit sie sich im Boden langsamer auflösen und ihre Nährstoffe dosierter freisetzen.
Was tun wir jetzt?
Bei all diesen Eintragspfaden fällt auf, dass sie meistens nicht mit dem klassischen Bild der in den Wald geworfenen PET-Flasche übereinstimmen, die langsam an einem Ort verrottet. Stattdessen haben sie oft einen Zweck – und als Nebeneffekt werden großflächig beachtenswerte Mengen feinster Partikel in unsere Bodenökosysteme eingetragen, sodass wir mit dem klassischen „Einsammeln und Recyceln“ nicht weiterkommen.
Verstehe, was die Zukunft bringt!
Als Mitglied von 1E9 bekommst Du unabhängigen, zukunftsgerichteten Tech-Journalismus, der für und mit einer Community aus Idealisten, Gründerinnen, Nerds, Wissenschaftlerinnen und Kreativen entsteht. Außerdem erhältst Du vollen Zugang zur 1E9-Community, exklusive Newsletter und kannst bei 1E9-Events dabei sein. Schon ab 2,50 Euro im Monat!
Jetzt Mitglied werden!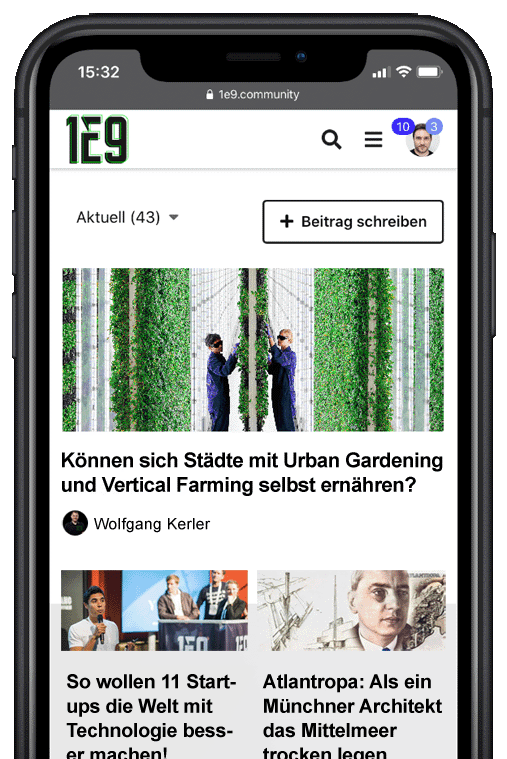
Trotzdem gibt es Wege, die zukünftige Kontamination der Böden mit Mikroplastik zu reduzieren. Während sich die Menge von Kunststofffasern im Abwasser mit Mikroplastikfiltern eindämmen lässt, die von Konsument:innen im Ablauf eingebaut oder von den Hersteller:innen in die Waschmaschinen integriert werden können, löst sich das Problem nur dann grundlegend, wenn andere Materialien in der Textilproduktion eingesetzt werden. Hier können gesetzliche Regelungen für die Hersteller:innen Produktion und Konsum lenken, gerade wenn sich Menschen der Problematik nicht bewusst sind oder aus finanziellen Gründen nicht auf sie reagieren können. Komposte aus städtischem Müll bleiben nur sauber, wenn wir unseren Bioabfall ohne Plastiktüte und anderen Plastikmüll in die Tonne werfen, denn kleinste Schnipsel Plastik abzutrennen ist für Kompostwerke technisch einfach nicht möglich.
Die Wahl des Mulch-Materials im Gemüseanbau wiederum liegt bei den Landwirt:innen. Ihre Lösung könnte im Rückgriff auf biologischen Mulch bestehen, der auch zum Humusaufbau beitragen kann, oder im Einsatz von Folien, die sie auf jeden Fall behalten und pflegen wollen, etwa Photovoltaikmulchfolien aus flexiblen Solarpanelen, die den Acker zum Kraftwerk machen würden – aber die existieren noch nicht. Auch etwas dickere Folien mit Pfand wären denkbar, die nicht während der Ackersaison zerfallen und einen UV-Indikator haben, der anzeigt, wann sie ins Recycling gegeben werden müssen.
Die Düngemittelindustrie wiederum muss verpflichtet werden, ihre Mineraldünger wenn überhaupt nur noch mit leicht abbaubaren Coatings zu überziehen, und die Landwirt:innen sollten ihr Wissen nutzen, um sich zu überlegen, ob sie mit einer ausgeklügelten organischen Düngung nicht in Teilen dasselbe oder mehr erreichen wie mit gecoateten Mineraldüngern.
Wenn wir all diese Arbeit so vor uns sehen, erscheint uns der Acht-Kubikkilometer-Plastikwürfel gar nicht mehr so groß, oder? Er passt mühelos in einen mittleren Berg der Alpen, und nur ein kleiner Teil von ihm ist in die Bodenumwelt gelangt. Wir könnten uns also zurücklehnen – oder realisieren, dass scheinbar schon diese Mengen ausreichen, um Ökosysteme zu stören. Unsere Beobachtungen warnen uns, trotz aller Unsicherheiten und Wissenslücken, das Vorsorgeprinzip walten zu lassen und der Reduzierung der Mikroplastikeinträge in die Umwelt Zeit zu widmen. Denn der Wohlstand, der uns das Plastik-Zeitalter entlang begleitet hat, basiert nicht auf Plastik, sondern auf gesundem Boden, sauberer Luft, klaren Gewässern und einer intakten Biosphäre. Das sollten wir uns immer klar machen, wenn wir überlegen, die Natur für einen gewohnten Lebensstil zu gefährden.
Dr. Fredi Büks forscht an der TU Berlin am Fachgebiet Bodenkunde zu den Themen Bodenfruchtbarkeit, Bodenstruktur und Regeneration von Bödenökosystemen und unterstützt mit dem Mamasoil-Kollektiv Projekte des sozialökologischen Wandels.
Hat dir der Artikel gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung! Werde Mitglied bei 1E9 oder folge uns bei Twitter, Facebook oder LinkedIn und verbreite unsere Inhalte weiter. Danke!
Titelbild: Getty Images
