Die Stadt der Zukunft soll essbar sein – und zur Anbaufläche für Salat, Obst und Gemüse werden. Das fordern nicht nur Umweltschützer, sondern auch die EU-Kommission, Start-ups oder FDP-Politiker. Die Angst vor Versorgungsengpässen wird durch die Corona-Krise noch verstärkt. Aber wie kann Landwirtschaft in Städte funktionieren? Welche Rolle kann Technologie dabei spielen? Und könnte der Ertrag reichen, um ganze Metropolen zu ernähren?
Von Wolfgang Kerler
In Krisenzeiten verwandeln sich Städte in Gemüsegärten. Am Ende des Ersten Weltkriegs rief der amerikanische Präsident Woodrow Wilson die Bevölkerung dazu auf, Victory Gardens anzulegen. Nur so könnte verhindert werden, dass Millionen von Menschen hungern müssen, wird in einer 1919 erschienenen Broschüre der National War Garden Commission erklärt. Schließlich müsse Amerika auch das vom Krieg zerstörte Europa ernähren – und dafür würde die Produktion der industriellen Landwirtschaft nicht ausreichen. Die einzige Lösung seien also die kleinen Gärten, Hinterhöfe und Brachen in Städten und Vorstädten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Victory Gardens wiederbelebt. 20 Millionen von ihnen sollen den amerikanischen Bedarf an frischem Salat und Gemüse zu fast 40 Prozent gedeckt haben. Auch die deutschen Städte der Nachkriegszeit waren bepflanzt, vor dem Brandenburger Tor wuchs Gemüse. Dann übernahmen in den USA und Europa wieder die großen Landwirtschaftsbetriebe die Versorgung. Die meisten Städter pflanzten Blumen statt Salat. Das könnte sich ändern.
 Ein Bild von 1947. Damals wurde der zerstörte Tiergarten in Parzellen aufgeteilt, um der hungernden Bevölkerung den Anbau von Gemüse zu ermöglichen. Bild: Otto Donath / Bundesarchiv
Ein Bild von 1947. Damals wurde der zerstörte Tiergarten in Parzellen aufgeteilt, um der hungernden Bevölkerung den Anbau von Gemüse zu ermöglichen. Bild: Otto Donath / Bundesarchiv
Der Trend zur städtischen Landwirtschaft könnte beschleunigt werden
Von Zuständen wie damals sind wir weit entfernt. Doch die Corona-Krise erinnert die Bevölkerung in den Städten daran, dass ihre Versorgung mit Lebensmitteln keine Selbstverständlichkeit ist – und auf teils komplexen Wertschöpfungsketten beruht. Das Bundesministerium für Landwirtschaft muss explizit darauf hinweisen, dass die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Milch oder Zucker „in der derzeitigen Lage“ gesichert sei. Komplizierter stellt sich das bei Obst und Gemüse dar, das importiert wird oder nur mit Unterstützung ausländischer Saisonarbeitskräfte geerntet oder gepflanzt werden kann. Erdbeeren und Spargel könnten teurer werden, heißt es bereits. Es sei denn, die wegbrechende Nachfrage der Gastronomie drückt die Supermarktpreise.
Werde Mitglied von 1E9 – schon ab 3 Euro im Monat!
Als Mitglied unterstützt Du unabhängigen, zukunftsgerichteten Tech-Journalismus, der für und mit einer Community aus Idealisten, Gründerinnen, Nerds, Wissenschaftlerinnen und Kreativen entsteht. Außerdem erhältst Du vollen Zugang zur 1E9-Community, exklusive Newsletter und kannst bei 1E9-Events dabei sein.
Jetzt Mitglied werden!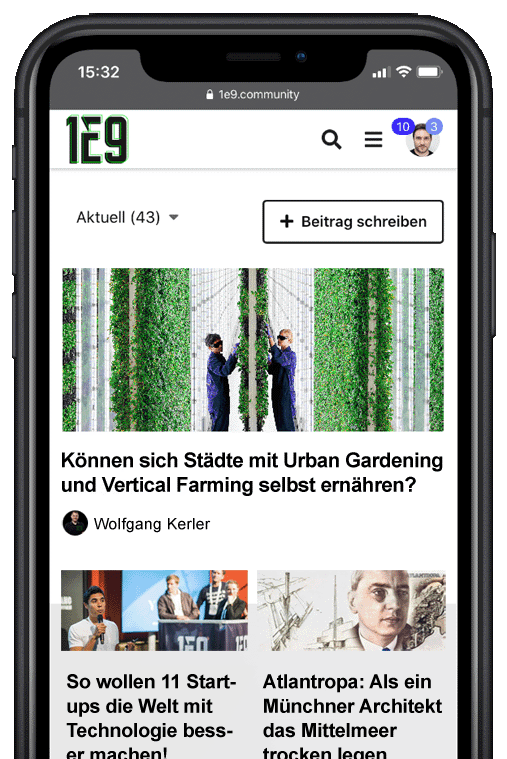
Auf jeden Fall steigert die Krise den Wunsch nach städtischer Selbstversorgung, wie die New York Times, das ZDF, oder Thomson Reuters berichten. Eine Entwicklung, die seit Jahren gefordert – und inzwischen auch gefördert – wird, könnte daher Fahrt aufnehmen. Um Städte resilienter, also widerstandsfähiger gegen und handlungsfähiger in Krisen zu machen, soll ihre Abhängigkeit von Lebensmittellieferungen sinken. Lange Transportwege sollen reduziert werden.
Und es sind längst nicht mehr nur NGOs wie Green City in München, die sich auch deshalb für urbane Gärten einsetzen. Die Bundesregierung finanziert Projekte, die neue Möglichkeiten für die Landwirtschaft in der Stadt erforschen sollen – auch wenn Bund und Länder die Dächer ihrer Häuser bisher eher für Solarpaneele reservieren als für Beete, wie aus der Antwort auf eine FDP-Anfrage im Bundestag hervorgeht. Die EU-Kommission wiederum unterstützt das EdiCitiNet, das Netzwerk der essbaren Städte. Und vor allem arbeiten viele gemeinnützige Projekte und Nachbarschaftsinitiativen, aber auch Start-ups an neuen Lösungen – vom sympathischen Community-Garten bis zur High-Tech-Untergrund-Salatfabrik.
Gemeinschaftlich Gärtnern auf traditionelle Weise
Ohne technologischen Schnickschnack kommt die traditionellste Art aus, in der Stadt Lebensmittel zu produzieren. Sie besteht im Anlegen von Gemüsebeeten – am Balkon, im Vorgarten oder Hinterhof, auf dem Flachdach, zusammen mit einer Gemeinschaft und vielleicht im unbeheizten Gewächshaus. Das klingt nach Hobby, ist aber durchaus ernst zu nehmen.
In Havanna, zum Beispiel, wird die Hälfte des Obsts und Gemüses, das die Millionenstadt verbraucht, auch innerhalb der Stadt angebaut – in den Organopónicos. Das sind gemeinschaftlich bewirtschaftete Felder, teils staatlich, teils in den Händen der Bevölkerung, auf denen Bio-Landbau betrieben wird. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die Kuba mit Grundnahrungsmitteln, aber auch Pestiziden belieferte, milderten die Organopónicos den Lebensmittelmangel und schufen Arbeitsplätze.
Auch in vielen Metropolen der Industrieländer, in denen Supermarktregale voll sind, entstanden in den vergangenen Jahren Gemeinschaftsgärten. Prominente Beispiele sind die Prinzessinnengärten in Berlin oder die Michigan Urban Farming Initiative in der früheren Autostadt Detroit. Daneben finden sich Initiativen in kleineren Städten, etwa die Urbane Farm in Dessau. Auch solche Projekte können, obwohl ihre Lebensmittelproduktion eher gering und nicht überlebenswichtig ist, einen wertvollen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten, wie etwa eine 2016 erschienene Studie der Johns Hopkins University ergab.
Vom Strukturwandel betroffene Nachbarschaften blühen – auch optisch – wieder auf, es entstehen neue soziale Bindungen innerhalb der Bevölkerung und es gibt Raum für Bildungsprojekte und für einen Ausgleich zum Berufsalltag. Es kann allerdings auch passieren, dass sich gestresste Gutverdiener mit ihren Parzellen in Stadtteilen, die eher von Menschen mit niedrigem Einkommen bewohnt werden, einnisten. Dann besteht die Gefahr, dass die Gärten zu einer exklusiven Veranstaltung werden.
Als ökologischen Pluspunkt machten die Johns-Hopkins-Wissenschaftler aus, dass die neuen Grünflächen für mehr saubere Luft sorgen, zur Kühlung der Stadt beitragen können und zusätzlichen Lebensraum für Insekten schaffen. LKW-Fahrten von Ackern in die Stadt braucht es außerdem nicht. Der Haken: Setzen Freizeitgärtner auf Pestizide, kann es passieren, dass sie diese weniger effizient einsetzen als Profi-Landwirte. Auch der Wasserverbrauch pro Pflanze könnte höher sein.
Städtische Farmen mit neuer Technologie
Während das Urban Gardening noch ziemlich viel mit den Victory Gardens von vor hundert Jahren gemeinsam hat, waren die durch technologische Fortschritte entstandenen Formen des Indoor und Vertical Farmings damals noch undenkbar. Sie setzen auf künstliches Licht, moderne Bewässerungs- und Aufzuchtformen, die gezielte Steuerung von Luftstrom und Temperatur sowie auf vertikalen Anbau in mehreren Schichten übereinander. Das funktioniert sowohl im kleinen Maßstab für Zuhause als auch im industriellen Großformat. Und es funktioniert das ganze Jahr über – unabhängig von Wind und Wetter.
Eine vertikale Farm im Miniaturformat hat, zum Beispiel, das Münchner Start-up Agrilution entwickelt: den Plantcube, der sich in eine Küchenzeile integrieren lässt. Auf zwei Ebenen können darin Salate oder Kräuter wachsen, vom wilden Rucola über Pak Choi bis zum Grünkohl. Erde braucht es keine. Die Samen kommen in Saatmatten, die aus einem Substrat bestehen, das aus Wollresten hergestellt wird. Die Nährstoffe für die Pflanzen wiederum sind im Wasser gelöst, in das die Wurzeln hängen.
„Wir schaffen im Plantcube das optimale Klima für die unterschiedlichen Wachstumsphasen“, erklärt Max Lössl im Gespräch mit 1E9. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Agrilution. Automatisch reguliert das Gerät die Bewässerung und das LED-Licht sowie den Luftstrom. Der Nutzer kann das über die App verfolgen und muss nur ab und zu Wasser und Nährstofflösung nachfüllen. Einige der verfügbaren Pflanzensorten lassen sich schon nach weniger als zwei Wochen ernten. Noch kostet der seit 2019 erhältliche Plantcube zwar fast 3.000 Euro. Doch das soll sich in den kommenden Jahren ändern: „Unser Ziel ist ganz klar, ein Produkt für die breite Masse anzubieten.“
Andere Start-ups verwenden eine vergleichbare Technologie, bauen aber deutlich größere Anlagen als Agrilution. Infarm aus Berlin, zum Beispiel, stellt seine vertikalen Farmen direkt in Supermärkten auf, wo die Kunden das Wachstum der Kräuter und Salate, die sie später kaufen, mitverfolgen können. Growing Underground baut in London in einem alten Luftschutzbunker – 33 Meter unter der Erde – Salat und Kräuter an. In Seoul, Südkorea, eröffnete vergangenes Jahr die erste Metro Farm in einer U-Bahn-Station. Und ganze Vertical-Farming-Fabriken, die Supermärkte in derselben Stadt beliefern, will die von Amazon-Chef Jeff Bezos mitfinanzierte, amerikanische Firma Plenty in den USA und China errichten.
Japan ist sogar schon weiter. Dort wächst das Vertical Farming insbesondere seit der Atomkatastrophe von Fukushima, weil sich die Verbraucher seitdem verstärkt Sorgen um sichere Lebensmittel machen. Dafür sind sie auch bereit, höhere Preise zu zahlen. Außerdem setzt das Land wegen seiner alternden Gesellschaft ohnehin stark auf Automatisierung, die bei Indoor-Salatfabriken noch weiter vorangetrieben werden kann. Und so werden die Salate in der neuen Anlage des Unternehmens Spread, die in einer früheren Fabrik untergebracht ist, von Robotern eingepflanzt. Bei voller Kapazität will Spread von dort 30.000 Salatköpfe pro Tag ausliefern.
Es gibt viele Argumente, die aus Sicht der Vertical-Farming-Unternehmen für diesen technologisch aufwendigen, aber städtischen Lebensmittelanbau sprechen: deutlich weniger Wasser- und Düngerverbrauch, keine Pestizide, Unabhängigkeit von Wetter und Klima und dadurch häufigere und sichere Ernten, keine oder deutlich kürzere Transportwege, weniger Verlust von Lebensmitteln am Feld oder bei der Lieferung, deutlich frischere Produkte, weniger Verpackungsmüll und viel weniger Flächenverbrauch. Diese Vorteile nennt auch das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in einer Studie von 2018, für die es Dutzende Urban-Farming-Projekte weltweit untersuchte.
Ganz ohne Menschen will das amerikanische Start-up Iron Ox in seinem Roboter-Gewächshaus auskommen.
Dennoch wird Vertical Farming immer wieder kritisiert, auch von Umweltschützern. Der Grund: der hohe Energieverbrauch für künstliches Licht und Kühlung. Die Zahlen, um wieviel der CO2-Fußabdruck von Salat oder Gemüse aus vertikalen Farmen den von konventionellen Produkten übersteigt, variieren jedoch. Mal ist von zwei bis 30-mal so hohen Emissionen die Rede, mal von sieben bis 20-mal. Und das trotz der wegfallenden Transportwege.
Das Problem ist in der Branche bekannt, daher sagt Max Lössl von Agrilution: „Vertical Farming macht nur Sinn, wenn man es mit erneuerbaren Energien betreibt.“ Deswegen empfiehlt das Start-up, den Plantcube mit Ökostrom zu verwenden und arbeitet daran, die eigene Lieferkette nachhaltiger zu machen.
Der Strombedarf des Vertical Farmings ist übrigens auch der Grund dafür, weshalb sich bisher vor allem der Anbau von Pflanzen rechnet, die mehrmals pro Jahr geerntet und nur gekühlt und gut verpackt geliefert werden können – Salat und Kräuter etwa oder Tomaten. Bei ihnen spielt die Technologie ihren Vorteil aus. Bei Weizen oder Mais sind die niedrigen Preise des klassischen Anbaus dagegen bisher unerreichbar.
Wachsende Weltbevölkerung, mehr Dürren, weniger Ackerfläche
Wird das Energieproblem überzeugend gelöst, dürfte Vertical Farming in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Davon geht die Fraunhofer-Studie aus. Denn die Weltbevölkerung soll bis 2050 von knapp siebeneinhalb auf fast 10 Milliarden Menschen wachsen, die Stadtbevölkerung von fast vier auf fast sechseinhalb Milliarden. Gleichzeitig dürften sich wegen des Klimawandels die Ernteausfälle des traditionellen Ackerbaus häufen. Und es gibt noch ein Problem.
„Die Böden sind fast überall, wo Landwirtschaft betrieben wird, überdüngt“, sagt Max Lössl. „Und es gibt kaum noch zusätzlichen, nährstoffreichen Boden, den wir nutzen könnten.“ Tatsächlich verbraucht die Menschheit schon jetzt 80 Prozent der kultivierbaren Fläche für Landwirtschaft, von der aber immer mehr durch Pestizide, Dünger oder Erosion verloren geht. Angesichts dieser Entwicklungen investieren Staaten, die bisher aufgrund ihrer klimatischen Bedingungen fast ausschließlich von Nahrungsmittelimporten abhängig sind, in urbanes Vertical Farming. So kündigte Abu Dhabi gerade ein 100 Millionen Dollar schweres Investitionsprogramm an. Hält dieser Trend an, könnten Farmscraper, also Hochhäuser für Vertical Farming, irgendwann tatsächlich gebaut werden. Architekten und Designer wie Chris Jacobs oder Vincent Callebaut entwickeln dafür seit Jahren Konzepte.
Bleibt noch die Frage, inwiefern sich Städte mit einem Mix aus Urban Gardening, Indoor und Vertical Farming selbst ernähren könnten. Darauf liefert eine internationale Studie von 2018 eine Antwort, für die auch die verfügbaren Flächen untersucht wurden: Sie kommt zum Ergebnis, dass fünf bis zehn Prozent des weltweiten Gemüsebedarfs durch urbane Landwirtschaft gedeckt werden könnten. Von einer Selbstversorgung ist das weit entfernt, könnte aber in Krisenzeiten einen entscheidenden Unterschied machen.
„Eine Stadt wie München hat im Schnitt Lebensmittelvorräte von drei bis fünf Tagen“, sagt Max Lössl. „Wenn in dieser Zeit keine Lieferungen nachkommen, wollen wir uns gar nicht ausmalen, was passiert.“ Er plädiert deshalb für eine dezentrale Landwirtschaft – und ist davon überzeugt, dass eine Stadt sich durchaus selbst ernähren könnte. „Auf jeden Fall könnten wir erheblich unabhängiger von traditionellen Lieferketten werden.“ Er selbst kann sich während des Shutdowns übrigens den ein oder anderen Gang zum Supermarkt sparen, weil er täglich in seiner Küche Salat oder Kräuter erntet.
Titelbild: Eine Vertical Farm des US-Start-ups Plenty. © Plenty




